
Politische Angst – damals und heute
ULRICH TEUSCH, 18. Dezember 2020, 12 KommentareI.
Sie heiße Jana, sagte sie, komme aus Kassel – und fühle sich wie Sophie Scholl. Diese Aussage, gesprochen auf einer Demo gegen die Anti-Corona-Maßnahmen im November 2020, war für die Vertreter der alternativlosen Politik und ihre medialen Transmissionsriemen ein gefundenes Fressen. Sie echauffierten sich nach Kräften. Und so musste Jana jede Menge Empörung, Spott, Häme, dazu allerlei historische Belehrungen über sich ergehen lassen.
Nachdem sie die Sache gebührend ausgekostet hatten, begaben sich die Kampfhunde wieder zur Ruhe. Rückblickend kann man sagen: Ja, natürlich hat sich Jana erschreckend naiv benommen. Sie hätte wissen, zumindest ahnen können, dass ihr Sophie-Scholl-Vergleich – ausgesprochen in diesem Land, bei dieser Gelegenheit – sie in Teufels Küche bringen würde.
Was allerdings bei der ganzen Aufregung möglicherweise übersehen wurde, ist dies: Könnte Janas Satz vielleicht gar nicht so gemeint gewesen sein, wie die meisten von uns ihn verstanden haben? Darf man ihr wirklich vorwerfen, dass sie sich auf eine Stufe mit Sophie Scholl stellen, also ihren Protest gegen die „Maßnahmen“ zu einem anti-nazistischen Widerstand überhöhen wollte? Darf man ihr ankreiden, dass sie zwei grundverschiedene Dinge verwechselte, nämlich den legitimen Widerspruch in einer Demokratie mit dem tödlichen Widerstand in einer Diktatur?
Ich glaube, das darf man nicht. Ich vermute vielmehr, dass Jana etwas ganz anderes im Sinn hatte. Sie wollte zum Ausdruck bringen, dass sie nunmehr – nach mehrmonatigen Erfahrungen mit einem repressiven Maßnahmenstaat – besser nachempfinden könne, wie es damals Sophie Scholl zumute gewesen sein muss. Jana glaubte jetzt zu verstehen, wie es sich „anfühlt“, unter permanentem Druck, in Unsicherheit und Angst zu leben.
II.
Ich habe mich viel mit den „dunklen Kapiteln“ der deutschen Geschichte beschäftigt. Dabei ging es mir nicht nur um historische Fakten, Zusammenhänge und Erklärungen, sondern immer auch um das emotionale Nachempfinden. Doch so sehr ich mich auch in das hineinzuversetzen suchte, was Zeitzeugen berichteten, was ich in Biografien und Autobiografien oder auch in Romanen fand, letztlich geriet ich immer an unverrückbare Grenzen. Trotz aller Identifikation mit den Opfern, trotz aller Empathie – ich verfüge lediglich über Bücherwissen, ich kenne das alles nur vom Hörensagen, ich bin nicht dabei gewesen.
Ich weiß nicht, wie einem Menschen zumute ist, wenn morgens um vier die Geheimpolizei an seine Haustür klopft. Wie fühlt man sich, wenn man an die Front abkommandiert wird, ein Kampfflugzeug steuert, im Luftschutzbunker kauert oder nichts mehr zu essen hat? Wenn man im Steinbruch Sklavenarbeit verrichtet? Oder wenn man einen gelben Stern trägt? Oder zu einem Sammelpunkt getrieben wird, um anschließend in einen Eisenbahnwaggon Richtung Osten gepfercht zu werden? Anders formuliert: Ich kenne keinen Krieg, keine Diktatur, keine Verfolgung. Oder nochmals anders: Ich habe noch nie politische Angst aushalten müssen.
Das hat sich geändert. In den vergangenen Monaten litt ich oft unter Angstzuständen. Sie hatten unterschiedliche Ursachen, waren von unterschiedlicher Art (wobei die Angst vor dem Virus eine untergeordnete Rolle spielte). Wesentlich ist: Erstmals in meinem Leben bekam ich es mit politisch begründeter Angst zu tun. Sie hat die anderen Ängste manchmal überlagert, in jedem Fall verstärkt.
III.
Bis dato kannte ich auf politischem Feld nur Sorge, Anspannung, Ärger, Empörung. Nie fühlte ich mich unmittelbar und persönlich bedroht. Nun jedoch überwältigten mich die schlagartigen, herrischen politischen Eingriffe in mein Leben. Man nahm mir meine Grundrechte. Selbst auf mein Recht, Rechte zu haben, war kein Verlass mehr. Die politische Angst kroch langsam an mir hoch, zunehmend beherrschte und lähmte sie mich – bis hin zur Arbeitsunfähigkeit.
In dieser Krise griff ich, ohne mir über die Gründe bewusst gewesen zu sein, zu Büchern, die ich zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal gelesen hatte. Diese Texte hatten etwas gemeinsam: Sie alle beschreiben das Leben unter totalitären Bedingungen, sie zeigen, wie eine unheimliche, angsteinflößende Bedrohung stetig wächst und näher kommt. Was auch immer der Einzelne tut, um ihr zu entgehen, ob er sich anpasst oder widersetzt – die Dinge nehmen unerbittlich ihren Lauf, und am Ende stehen Flucht oder Tod.
Ich las noch einmal Bernard von Brentanos leider weithin vergessenen, beklemmenden Roman „Prozeß ohne Richter“, im Schweizer Exil entstanden und 1937 in Amsterdam erschienen, sodann Lion Feuchtwangers „Die Geschwister Oppermann“, die autobiografischen Aufzeichnungen des Historikers Felix Gilbert „Lehrjahre im alten Europa“, um nur einige zu nennen. Und ich las zwei neue Bücher von Norman Ohler und Sabine Friedrich über den antinazistischen Widerstand der Netzwerke um den Regierungsrat Arvid Harnack und den Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Boysen, dem deutschen Zweig der „Roten Kapelle“.
Während der Lektüre erging es mir, wie es Jana möglicherweise ergangen ist, als sie sich mit Sophie Scholl beschäftigte. Anders als bei früheren Lektüren der genannten oder ähnlicher Bücher konnte ich diesmal die Sorgen und Ängste der Protagonisten nicht nur verstandesmäßig begreifen, sondern mich erstmals in ihre Lage einfühlen. Warum gelang mir das, obwohl ich doch nach wie vor nicht in einer Diktatur lebte und niemand mich verfolgte, ja nicht einmal behelligte (so ich denn bereit war, Ruhe zu halten beziehungsweise präventiv geduckt umherzulaufen)?
Meine Antwort: Weil schon überwunden Geglaubtes wiederkehrt, weil wir nicht länger in einer Zeit der Aufklärung, sondern der Verdunkelung leben, auch in einem „Age of Anxiety“, einem Zeitalter der Angst (W.H. Auden). Seit Monaten fühle ich mich fremd im eigenen Land. Ich registriere Veränderungen, die mir gegen meinen Willen aufgezwungen werden, gegen die ich machtlos bin. Ich spüre, dass etwas Schweres, Bedrohliches, Unberechenbares in der Luft liegt, bilde mir sogar ein, dass ich es riechen und schmecken kann. Meine vertraute Lebenswelt ist in Auflösung begriffen. Ich halte Ausschau nach Fluchtwegen in bessere Welten, suche nach Subkulturen, in die ich abtauchen könnte. Und die politische Angst ist meine ständige Begleiterin.
IV.
Es ist schon ein paar Monate her: Ich betrat eine Arztpraxis und trug meine Alltagsmaske ein wenig nachlässig, sodass die Nase hervorlugte. Die Sprechstundenhilfe an der Rezeption fixierte mich mit stechendem Blick und forderte mich auf, das umgehend in Ordnung zu bringen. Ich tat wie geheißen, doch sie war nicht zufrieden mit dem Ergebnis und verlangte mehrmals Nachbesserung. Es kam zu einem kleinen Wortwechsel, der mit meinem Rauswurf endete. Bevor ich ging, bemerkte ich noch: „Sie hätten 33 bestimmt auch mitgemacht!“ Worauf sie erwiderte: „Na, 33 war ja wohl etwas anderes!“
Tatsächlich? Was wollte die Dame mir damit sagen? Hätte sie, weil ja „33“ so ganz anders war, etwa nicht mitgemacht? Hätte sie aufbegehrt? Und wie kam sie überhaupt auf den Gedanken, dass „33“ so grundstürzend anders gewesen sei?
Es ist dies ein erstaunliches Phänomen, ich erlebe es immer wieder: Wenn man Menschen mit „33“ konfrontiert, dann assoziieren sie in aller Regel nicht die realen Verhältnisse dieses besonderen Jahres, sondern das, wofür die zwölf Jahre Nationalsozialismus in ihrer Gesamtheit stehen: Gleichschaltung, Führerprinzip, Gewalt, Terror, Krieg, Gaskammern, Zerstörung, Vernichtung.
All das war jedoch 1933, kurz nach der „Machtergreifung“, allenfalls zu mutmaßen oder bloß rudimentär entwickelt. Es war keineswegs so, dass die Weimarer Republik am Stichtag 30. Januar 1933 endete und postwendend die Nazi-Diktatur begann. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler war zwar ein eminent wichtiges Ereignis, aber sie war nicht die Scheidelinie zwischen Demokratie und Diktatur.
Durch Hitlers „Machtergreifung“ wurde die Weimarer Reichsverfassung nicht außer Kraft gesetzt, Deutschland erfreute sich fürs erste weiterhin einer bunten Parteienlandschaft und eines pluralistischen Mediensystems. Auch die Frage, ob es wohl doch noch zu einem Aufbäumen der Arbeiterbewegung kommen würde, stand nach wie vor im Raum. Und immer wieder konnte man ermutigende Zeichen des Protests oder des Widerstands bemerken. Selbst der „Tag des Boykotts“ gegen jüdische Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte am 1. April 1933 verlief nicht so erfolgreich, wie sich die Nazis das gewünscht hatten.
Viele NS-kritische Journalisten blieben seinerzeit erstaunlich gelassen. Sie schrieben, dass Hitler nun – als Chef einer Koalitionsregierung – beweisen müsse, was er kann; angesichts der riesigen Problemlast erwarteten nicht wenige seine baldige Entzauberung, seine Reduktion auf Normalmaß und die Disziplinierung seiner „Bewegung“. Die Annahme, dass er sich nicht lange werde halten können, war weitverbreitet. Am 1. Februar 1933 schrieb zum Beispiel die liberale „Frankfurter Zeitung“:
„Es ist eine hoffnungslose Verkennung unserer Nation, zu glauben, man könne ihr ein diktatorisches Regime aufzwingen. Die Vielfältigkeit des deutschen Volkes verlangt die Demokratie (…) Daß die wahre deutsche Volksgemeinschaft demokratisch ist, bezweifeln wir heute so wenig wie je.“
Ende Februar brannte der Reichstag, unmittelbar danach kam die Notverordnung „zum Schutz von Volk und Staat“, mit der die Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden; es setzte eine Welle der Repression gegen Kommunisten und Sozialdemokraten ein. Am 5. März fanden die letzten Reichstagswahlen statt. Obwohl alle Zeichen auf Sturm standen, ließ sich die „Frankfurter Zeitung“ nicht irre machen. Am 6. März schrieb sie:
„Die Regierung hat die Majorität, aber diese Majorität ist nicht gleichbedeutend mit dem gesamten Volk (…) Die Regierung darf innerhalb der Legislaturperiode von vier Jahren die Dinge verantwortlich leiten. Zu dieser Verantwortung gehört der Respekt vor der Opposition.“
Die sogenannte Machtergreifung war in Wahrheit eine Machterschleichung, mit der zu Beginn des Jahres 1933 (als Deutschland übrigens von einer schweren Grippeepidemie heimgesucht wurde und es vielerorts schulfrei gab) niemand ernsthaft gerechnet hatte. Viele Nazigegner gaben sich Illusionen hin oder frönten einem Wunschdenken. Hatte denn die NSDAP bei den Reichstagswahlen im November 1932 nicht erstmals herbe Verluste hinnehmen müssen? Vielen schien es, als habe die Partei ihren Zenit überschritten und befände sich auf dem absteigenden Ast.
Stellt man in Rechnung, dass der Machtübernahme der NSDAP eine dreijährige Agonie der Weimarer Republik vorausgegangen war, in der mit Präsidialkabinetten und Notverordnungen regiert wurde, und dass im Sommer 1932 die preußische Regierung durch einen Staatsstreich aus dem Amt gefegt worden war, dann muss man realistischerweise sagen: Die Etablierung der NS-Diktatur kam nicht mit einem Schlag, sie war kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess, der sich über etwa vier Jahre hinzog. Die Deutschen sind langsam in die Diktatur hineingewachsen. Irgendwann, irgendwo wurde der point of no return überschritten. Danach ging alles mit atemberaubender, die Widerstandskräfte lähmender Geschwindigkeit.
Ich behaupte nicht, dass wir heute in einer gleichartigen Situation seien oder dass sich die Geschichte wiederhole. Aber wir sollten den Ernst der Lage begreifen. Wenn wir eine Lehre aus unserer Geschichte ziehen können, dann lautet sie: Seid wachsam und wehret den Anfängen!
V.
Die Kontroversen um die Gefährlichkeit des Virus und die Angemessenheit der „Maßnahmen“ haben die Gesellschaft polarisiert. Beziehungen zwischen Menschen, selbst langjährige, scheinbar stabile Freundschaften, wurden zerstört oder harten Belastungsproben ausgesetzt. Ich habe diese Zuspitzung von Anfang an für fatal gehalten. Doch in letzter Zeit beobachte ich, dass ich mich selbst an ihr beteilige und immer unduldsamer werde.
Im Frühjahr 2020 sagte Jens Spahn: „Wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen.“ Eine erstaunliche Aussage! Was mich betrifft: Ich habe nichts gesagt oder getan, was Herr Spahn mir verzeihen müsste. Umgekehrt sieht die Sache anders aus. Meine Familie ist im Frühjahr 2020 um Haaresbreite an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Dieses familiäre Desaster war nicht allein den Anti-Corona-Maßnahmen geschuldet, wohl aber haben diese Maßnahmen uns (beinahe) den Rest gegeben.
Im Frühherbst konnten wir endlich Licht am Ende des Tunnels erkennen. Doch nun, im Winter und mit dem neuerlichen Lockdown, droht sich zumindest diese Geschichte zu wiederholen. Was unser Leben in den vergangenen Wochen strukturiert und stabilisiert hatte, löst sich von heute auf morgen in Luft auf: keine Planungssicherheit mehr, kein Präsenzunterricht in den Schulen, Therapiegruppen dürfen sich nicht mehr treffen, ebenso wenig Sportgruppen, soziale Beziehungen (insbesondere der Kinder) werden weithin eingefroren etc. Und die politische Angst, die ich halbwegs unter Kontrolle gebracht hatte, kehrt mit Macht zurück.
Was um alles in der Welt sollte ich also Herrn Spahn verzeihen? Und was seiner Chefin? Die Dame mit den hängenden Mundwinkeln und dem Tunnelblick – sie scheint sich mehr denn je in einem Vernichtungskrieg gegen das Virus zu wähnen. Es sieht aus, als wolle sie mit ihren Durchhalteparolen dem britischen Kriegspremier Winston Churchill nacheifern. Mit dessen rhetorischen Fähigkeiten kann sie es zwar nicht ansatzweise aufnehmen, aber zumindest äußerlich sieht sie ihm immer ähnlicher.
Ich habe nie daran geglaubt, dass das Private politisch sei; wohl aber schlägt das Politische mitunter brachial ins Private, ins Persönliche durch. Wenn das geschieht, gibt es nichts mehr zu verzeihen. Im Gegenteil, man sollte das Politische persönlich nehmen.
VI.
In seinem Artikel „Merkel und ihren apokalyptischen Reitern geht der Gaul durch“ schrieb Robert von Loewenstern:
„Entgegen landläufiger Meinung leben wir nicht in einer Demokratie, sondern in einem demokratischen Rechtsstaat. ‚Rechtsstaat‘ ist aus gutem Grund das Hauptwort, ‚demokratisch‘ nur das Wiewort. Staatskundliche Merkregel: Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Rechtsstaat ist, wenn das Schaf das Abendessen überlebt.“
Eine zutreffende, anschauliche, einprägsame Definition. Wir erleben in der Tat weniger eine Krise der Demokratie als eine Krise der Verfassung, des Rechtsstaats, der Rechtssicherheit, der Rechtsprechung.
Was sich in diesem Land (und in ähnlicher Form in anderen Ländern) seit zehn Monaten abspielt, mutet an wie eine nicht enden wollende „Stunde der Exekutive“. Es agiert eine in der Verfassung nicht vorgesehene, sich selbst ermächtigende Runde aus Kanzler und Ministerpräsidenten – nicht viel mehr als ein Dutzend Leute. Und diese Leute können ziemlich ungestört tun und lassen, was sie wollen. An ihrem Gebaren ist zu erkennen: Es geht ihnen ganz offenkundig weniger um Viruskontrolle als um Menschenkontrolle. Ihrer Selbstermächtigung korrespondiert die Selbstentmachtung der Parlamente, allen voran des Bundestages. Dritter im Bunde ist die Judikative, die – von wenigen Ausnahmen abgesehen – eine klägliche Vorstellung bietet.
Was treibt die Akteure an? Ist es ein perfider Masterplan? Ist es die pure Panik? Ist es der aufrichtige Wille, der Menschheit Gutes zu tun? Ist es Dilettantismus, Überforderung, Unfähigkeit, Politik- und Staatsversagen großen Stils? Sicher ist: Wenn das alles einmal endet (wenn es denn jemals endet), wird es wenige Gewinner und viele Verlierer geben. Aber selbst die Gewinner werden sich in einer anderen, weithin zerstörten Welt wiederfinden.
Schon jetzt ist ja ein merkwürdiges Schauspiel zu beobachten: Diejenigen, die nicht müde werden, uns mit irgendwelchen sinnfreien Maßnahmen zu traktieren, nehmen für sich keine Sonderrechte in Anspruch, sondern unterwerfen sich ebenfalls den von ihnen erdachten Regeln. Die Großkopferte aus dem Kanzleramt läuft vermutlich öfter mit Maske herum als Sie und ich. Und auch sie darf nicht mehr ins Konzert oder in die Oper, nicht mehr zu großen Fußballmatches oder gar in die Umkleidekabine der Nationalelf; ihr nobles Lieblingsrestaurant hat geschlossen, die entspannte Shoppingtour durch Designerläden fällt flach. Sie darf regieren, aber muss ansonsten auf alles verzichten, was das Leben lebenswert macht.
Selbst die Davos-Milliardäre werden sich nicht ewig in einer Parallelgesellschaft mit gated communities, Luxusyachten und Privatjets abschotten können. Sie leben auch auf dieser Welt. Und irgendwann werden sie mit den Folgen ihres Tuns konfrontiert werden, also dem, was die von ihnen entfesselten Destruktivkräfte im globalen Maßstab angerichtet haben. Kein „Great Reset“ und kein anderer, vergleichbar wahnwitziger Plan wird sie retten. Aber bis sie das begriffen haben, werden noch viele Opfer zu erbringen sein. Wir gehen Zeiten großer politischer Angst und großen politischen Schreckens entgegen.

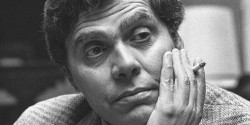
Diskussion
12 Kommentare